
"Seit der Erfindung der Vergrößerungsgläser haben die unsichtbaren Dinge ein böses Spiel; und man braucht nur ein Geist zu sein, um alle Mühe von der Welt zu haben, die Leute von seinem Dasein zu überzeugen."
Wieland (Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva)
 |
Tun wir einfach so, als wäre die Kenntnis des klassischen Kanons noch selbstverständlich. Das erspart Zeit und viele Worte, denn über Wieland und sein Werk schreiben, beinhaltet die Gefahr, sich in einem einzigartigen, komplexen, sehr vielschichtigen und längst noch nicht ausgelesenen Oeuvre zu verirren. Letztlich ersetzt doch keine sekundäre Betrachtung das Erlebnis der eigenen Lektüre, um so weniger beim Autor so tiefgründiger, höchst ironischer, ja witziger Werke wie des „Peregrinus Proteus“, des „Agathon“, des „Nachlass des Diogenes von Sinope“, des „Don Sylvio“, vor allem aber – die Krönung seines Schaffens – der einzigartigen „Geschichte der Abderiten“. Lest dieses Buch, Leute, es gehört zum Besten, was in deutscher Sprache je geschrieben wurde! In ihm ist fast der ganze Wieland in nuce enthalten. Man kommt unweigerlich ins Schwärmen bei diesem Autor, schon deswegen muss der eingängige Selbstbetrug herhalten.
Unter seinen im vierundzwanzigsten Band der „Sämmtlichen Werke“ veröffentlichten Schriften, der „Vermischte Aufsätze Literarischen, Filosofischen und Historischen Inhalts“ umfasst, befindet sich die bislang wenig beachtete Schrift „Über die ältesten Zeitkürzungsspiele“. Sie hat weder in die Wielandforschung noch in die spieltheoretische- oder gar Schachliteratur, soweit zu sehen ist, Eingang gefunden1. Und das verwundert, allein weil der große Wieland ihr Schöpfer ist.
Schon über den Begriff des „Zeitkürzungsspiels“ mag der aufmerksame moderne Leser stolpern, der noch den Zeitverlust, die Zeitverschwendung, den Zeitvertreib kennt. Zeitkürzung, so belehrt uns das unübertroffene Grimmsche Wörterbuch2 steht für „kurtzweil“ und Unterhaltung, es ist ein Begriff der im Mittelhochdeutschen als „zîtkürzel“ bekannt war, die Zeitkürzung war Synonym für die Geliebte, „aber nicht mehr bei Schiller und Göthe belegt“, und das ist, wer den Grimm kennt, der ultimative Maßstab. Der Begriff des „Zeitkürzungsspiels“ nun ist allein bei Wieland bekannt, so dass man ihn beim Versuch vorfindet, ein neues tragfähiges Wort in den Wortschatz einzureihen. Die Konnotierungen klangen schon an, sie weisen in die Entspannungsrichtung zum einen, zum anderen in die Unterhalt(ungs)richtung. Man darf das wohl auch im existentiellen Sinne lesen. Zeitkürzungsspiele lassen uns die Zeit vergessen, beeinträchtigen angenehm die Wahrnehmung der Dauer, sie erleichtern das Dasein, sie nehmen ihm, zumindest eben zeitweise, dessen Lastcharakter ab und machen das Leben leichter, beschwingter, erträglicher. Hier klingen sicher Wielands stoische und kynische Saiten an. Sie, die Zeitkürzungsspiele, sind aber nicht Sinn der (Lebens)Zeit, auch nicht Ziel, nur Mittel! Wenn das alles aufs Schach zuträfe, so wäre es metaphysisch schon hier gerechtfertigt, mehr noch, es wäre notwendig.
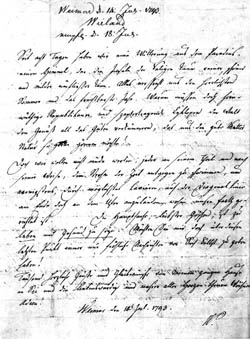 |
|
Handschrift Wielands |
Wielands Artikel eröffnet mit antiken Würfel- und Fingerspielen, er spricht von „Ergetzungsspielen ... bey den Griechen“, von sagenhaften vorrömischen Brot-und-Spiele-Politiken, er zitiert Herodot und Homer und kommt doch so schnurstracks zum Schachspiel, dass man den Eindruck nicht los wird, dies sei der eigentliche Gegenstand des Textes. Und tatsächlich widmet er sich diesem Spiel sehr ausführlich.
Anfangs gilt sein Interesse der Geschichte des Schachspiels, wehrt er sich gegen zeitgenössische Versuche, dessen Wurzeln nach Athen zu verlegen, die, so glaubt er, einer übersetzerischen Verwechslung des altgriechischen Kegelspiels Pessi mit dem altrömischen Brettspiel ludum latrunculorum, welches heutzutage besser als ludus romanus bekannt ist. Er kommt zu dem in modernen Ohren banal klingenden Schluss: „Das wahre Schachspiel ist aus einer viel späteren Zeit, und war in Europa vor den Kreuzzügen unbekannt. Es ist ein morgenländisches Spiel“ (103). In der Tat lesen sich die historischen Ausführungen wenig interessant, man hat das mittlerweile alles tausende Male, bis zum Erbrechen gehört und selbst zu Wielands Lebzeiten konnten diese Äußerungen keinen eignen Wert beanspruchen. Schließlich zitiert er nur, was Hyde, Frêret und andere schon ausgiebig bearbeiteten, man liest diesbezüglich nichts anderes als in S. F. Günther Wahls “Der Geist und die Geschichte des Schach-Spiels“3 aus dem Jahre 1798. Wenn man nicht voneinander abgeschrieben hat, dann lässt sich diese auffällige Übereinstimmung nur durch gemeinsame Quellen erklären. Faktisch kennt man das alles, die Erfindung des Spiels durch den weisen Brahmanen, dessen didaktischer Ansatz, die Getreidelegende, das Schatrang, die etymologischen Herkommen der Schachbegriffe und all das. Es zu referieren schien seinerzeit zumindest einem Laienpublikum gegenüber noch Sinn gemacht zu haben, immerhin schrieb Wieland: „Vielleicht ist der Leser neugierig zu wissen, wie der König von Indien den Braminen Sissa oder Nassir für einen so schöne Erfindung belohnte“ (106) – heut weiß das jeder, der schon mal in einem Schachbuch oder selbst in einer Schachzeitung geblättert hat, in der uns – darauf gehe ich jede Wette ein – mit unerschütterlicher Hartnäckigkeit immer und immer wieder Schopenhauers Misthaufen-Chimborazo-Vergleich, das Bild des ertrinkenden Elefanten oder Goethes “Probierstein des Gehirns“ kredenzt wird, als hoffe man auf einen Außerirdischen, der jene Phrasen noch nicht kenne. Man könnte, ganz in der Manier dieser Beweihräucherungspolitik, auch von Wieland nette Sentenzen zitieren, natürlich, das muss so sein, vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen: „Die ganze Beschaffenheit dieses edeln Spiels stimmt aufs vollkommenste mit dem Zweck überein“(106). Aber lassen wir das für bescheidenere Ansprüche.
Was wirklich an diesem Text bemerkenswert bleibt, ist viel eher die Form denn der Inhalt, ist auch der skeptische Blick des Aufklärers. „Ob der gute Bramine Nassir die Könige durch sein Königsspiel viel weiser und besser gemacht habe, wollen wir – nicht fragen“ (111f.), das ist ein Satz, der noch heute all die Phrasen vom angeblichen moralischen Wert des Schachs berghoch überragt. Man muss diese vordergründig inhaltliche Lektüre überwinden, um auf einen interessanten Effekt aufmerksam zu werden, den des Erzählens. Die morgenländischen Einflüsse sind im Erzählton am ehesten, wenn auch unauffälligsten präsent; wie ein arabischer Geschichtenerzähler tritt Wieland auf, sein Naturell kann er nicht verbergen. Tatsächlich spielt ein Großteil seiner literarischen Begebenheiten im Orient, viele seiner Charaktere sind in orientalische Trachten gekleidet und das liegt nicht nur an der zeittypischen Attraktion des Fremden, sondern auch im Bewusstsein, dass diese ferne Kultur ein anderes Zeitempfinden besitzt, welches sich in der Kunst des Erzählens entäußert. Zeitkürzungsspiele auf Arabisch oder Persisch sind Sprachspiele! Geschichte ist erzählte Zeit, sie ist die Summe der in/von ihr erzählten Geschichten. Immer im Plural. Der Geschichtssingular ist eine europäische Erfindung. Wieland lässt seine Leser, die heutigen, so sie es realisieren, mehr noch als die zeitgenössischen, an dieser Geschichtsauffassung verwundert teilhaben, und ein Gegenstand wie das Schach ist in seinem Munde bestens geeignet. Wenn wir heute vom Schach sprechen, dann meinen wir überhaupt etwas ganz anderes. Das ist auch der Grund, weshalb wir gut gemeinte Tips damaliger Schachtheoretiker als „falsch“ oder „naiv“ empfinden. Sie sind es auf die heutige Form bezogen durchaus, aber umgekehrt hätten Wieland, Wahl und andere einem modernen Theoriebuch nur kopfschüttelnd gegenübergestanden, weniger aus Verständnisproblemen heraus, sondern aus Akzeptanzgründen, denn sie hätten ihr geliebtes Schach gar nicht wieder erkannt, sie hätten darauf bestanden, dass sie, obgleich die Regeln sich nicht verändert haben, ein ganz anderes Spiel gemeint haben würden, sie hätten sich schließlich gewehrt, dies als „jenes edle Spiel“ anzuerkennen. Und mit allem Recht der Welt, allein schon, weil es ohne Geschichten auskommt. Erst als man aufhörte, sich Geschichten über das Schach zu erzählen oder solche zu erfinden, war der Weg zur wissenschaftlichen Erforschung frei, das Schach gewann nun endlich an Präzision und technischer Vervollkommnung, an Rationalität, verlor aber an Faszination und Zauber. Daher werden auch die alten Schachekstatiker immer wieder zitiert: man hat dem heute nichts mehr hinzuzusetzen. Als Zeitkürzungsspiel war es nur Mittel, nie Zweck! Was uns als letztes Überbleibsel alten Erzählreichtums blieb, sind die Meisteranekdoten, jene zahlreichen witzigen Szenen, denen Zeitlichkeit trotz allen Witzes vollkommen abgeht. Der fortgeschrittene Zauber des Spiels definiert sich Großteils in den Schrullen vereinseitigter Spezialbegabungen. Was ist dies gegen Wielands aufgelesene und neu entfaltetet Geschichte vom Tafelrundenritter – Schachforscher würden hier schon ungeduldig einhaken und darauf verweisen, dass am Hofe Arthurs es das Spiel gar nicht gegeben haben kann -, von Galleret, der auf der Suche nach Lanzelot in die verführerischen Fänge der Fee Floribelle gerät, ihr beim Schach auf riesigem Felde unterliegt – die Figuren werden mithilfe eines Zauberstabes bewegt -, zu deren Sklaven wird, um sie schließlich durch eine List doch noch zu besiegen und zu gewinnen? Da fragt niemand nach historischer Wahrheit, keiner verlangt eine Urkunde oder einen archäologischen Fund, niemand will Faktisches wissen, allein die Einwebung in diesen großen europäischen Erzählteppich, ganz Jenseits von Wahrheit und Lüge - weist auf den entscheidenden Unterschied hin.
Freilich lebt im Aufklärer schon der wissenschaftliche Trieb, da streiten sich verschiedene Seelen in seiner Brust. Daher ist Wieland in der Lage nach dieser zauberhaften Geschichte nahtlos zur historischen Kritik überzuwechseln - kann Karl der Große das Schachspiel gekannt haben? – und kippt dann doch wieder in die Märchenerzählerpose.
 |
|
Portrait von F. Jagemann |
Wenn nun aber der berühmte Autor der Forschung nichts Wirkliches hinzuzufügen hat, wenn er lediglich Lektüren referiert, wozu dann soll die Beschäftigung dienen? Wir nähern uns dem Kernstück des Aufsatzes, der wie so oft, nur geringen Raum einnimmt.
Wielands Anliegen, das wird deutlich, ist nicht die Auseinandersetzung mit sekundären akademischen Meinungen, es ist viel umfassender und zielt auf das Große. Dabei speist es sich aus einem neu erworbenen aufklärerischen Selbstbewusstsein: „Ein aufgeklärter Mensch verachtet nichts.“ – lautet sein programmatisches Geständnis – „Nichts was den Menschen angeht, nichts was ihn bezeichnet, nichts was die verborgenen Federn und Räder seines Herzens aufdeckt, ist dem wahren Filosofen unerheblich“ (129). Dieser emotionale Ausbruch bezieht sich natürlich auf das Spiel, auf diese Nebensächlichkeit, die befreit werden muss von spezifischen Begeisterungen für dieses oder jenes spezielle Spiel und sich in allgemeinen, in „filosofischen“ Überlegungen zu entäußern hat. „Und wo“, so fährt er zwangsläufig fort, „ist der Mensch weniger auf seiner Hut als wenn er spielt“ (130)? Will man den Menschen begreifen, so muss man an der schwächsten Stelle ansetzen, dort, wo er nicht auf der Hut ist. Damit wird eine historische Tradition angegriffen, die noch heutzutage die weit verbreitetste ist, denn noch immer wird Geschichte als die Aufeinanderfolge ihrer stärksten Ereignisse missverstanden und erst nach und nach erlangte in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein Gedanke Relevanz, der eben an den Schwachpunkten Wahrheit vermutet (Braudel, Febvre, Foucault, Levi-Strauss, um nur einige paradigmatische Namen dieser Richtung zu nennen). Mit Worten wie diesen, würde auch ein neuzeitlicher Denker sich nicht blamieren: „Worin spiegelt sich der Karakter einer Nazion aufrichtiger ab als in ihren herrschenden Ergetzungen? Was Plato von der Musik eines jeden Volkes sagte, gilt auch von seinen Spielen: keine Veränderung in diesen, (wie in jener) die nicht entweder die Vorbereitung oder die Folge einer Veränderung in seinem sittlichen oder politischen Zustande wäre“ (130)! Ein Plädoyer für das Unauffällige, das Marginale, welches den Kern der Sache, viel eher in den Blick bringt, als wenn man diesen selbst in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellte. Dabei legitimiert sich die Beschäftigung mit dem Nebensächlichen schon aus sich selbst. „Und warum sollten denn die Spiele der Menschen unserer Aufmerksamkeit unwürdig seyn?“ Man beachte, dass es hier nicht um die innere Logik eines Spiels geht. 99% der gesamten Schachliteratur hätten demzufolge nichts zu der von Wieland intendierten Beschäftigung beigetragen, er hätte deren Sinn, wie gesagt, gar nicht verstanden. „Spielen ist die erste und einzige Beschäftigung unserer Kindheit, und bleibt uns die angenehmste unser ganzes Leben durch. – Arbeiten wie ein Lastvieh ist das traurige Loos der niedrigsten, unglücklichsten und zahlreichsten Klasse der Sterblichen; aber es ist den Absichten und Wünschen der Natur zuwider.“ Diese fundamentalanthropologischen Aussagen speisen sich aus Wielands stoischer und kynischer Grundkonstitution, die selbst Teil einer anthropologisch fundierten Tradition ist4. In diesem Sinne fährt er fort: „Der Mensch ist nur dann an Leib und Seele gesund, frisch, munter und kräftig, fühlt sich nur dann glücklich im Genuß seines Daseyns, wenn ihm alle seine Verrichtungen, geistige und körperliche, zum Spiel werden. Die schönsten Künste der Musen sind Spiele“ (128).
Hier erweitert Wieland gar den stoischen Grundgedanken, der eine Ethik des Ertragens beinhaltet, verschafft diesem Erleichterung, indem er dem Leben eine spielerische Komponente verleiht. Versuchte die antike Stoa den Menschen davon zu überzeugen, alle Bürden zu tragen und zu ertragen, da sie zum großen Naturkomplex gehören und daher nur in der subjektiven Wahrnehmung Lastcharakter besitzen, aber keine an-sich-Gewichtigkeit, so will Wieland, freilich nur in Andeutung und in Antizipation Nietzsches5 – selbst diese Last hinwegspielen, alles zum Spiele erklären. „Nehmet vom Leben weg, was erzwungener Dienst der eisernen Nothwendigkeit ist, was ist in allem übrigen nicht Spiel?“ Und nun folgt eine äußerst brisante, leider nur angedeutete Auseinandersetzung mit dem polyvalenten Spielbegriff, die bis heute noch keine adäquate Fortsetzung gefunden hat. „Die Künstler spielen mit der Natur, die Dichter mit ihrer Einbildungskraft, die Filosofen mit Ideen und Hypothesen, die Schönen mit unsern Herzen, und die Könige – leider! – mit unsern Köpfen ... Bloß in der Beschaffenheit der Spiele und der Art zu spielen liegt der Unterschied, der ihren guten oder bösen Einfluß, ihre heilsamen oder verderblichen Folgen bestimmt: aber eben dies ist, was sie in der Karakteristik der Völker und Zeiten bedeutend und merkwürdig macht“ (129). Die alte und noch immer unentschiedene Diskussion darüber, was das Schach denn nun sei: Kunst, Wissenschaft, Spiel oder Kampf – oft entzieht man sich der Entscheidung indem man es allem zugleich zurechnet -, wirkt von Wielands Standpunkt aus eher kurios, denn rein sprachlich gesehen befinden wir uns in einem Limbus, wo eine sinnvolle Entscheidung gar nicht möglich scheint. So, wie es für viele Dinge keine Begriffe gibt, könnte es umgekehrt für viele Begriffe gar keine Dinge geben, zumindest keine, die sich zweifelsfrei zuordnen ließen und das ist im Bereich Sport – Spiel – Kampf besonders evident. Sprache ist hier zu unscharf, um Entscheidungen überhaupt plausibel machen zu können.
Im ganzen Abschnitt jedoch spricht sich ein frühes anthropologisches und ethnologisches Bedürfnis aus, artikuliert sich ein noch vages Verlangen nach Klarheit, das bis dahin noch unerhört blieb. Zu Lebzeiten konnte Wieland dieses Bedürfnis nicht mehr befriedigt sehen, wenngleich erste richtungsweisende Arbeiten, etwa die seines Freundes Herder („Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“) vorgelegt wurden, es bedurfte noch nahezu anderthalb Jahrhunderte, bis die Vorarbeiten es Denkern wie Buytendijk6, Huizinga7 oder Caillois8 ermöglichten, erste, mehr oder weniger präzise, Gesamtsummen zu ziehen. Die freilich schienen Wieland als ihren Vordenker nicht mehr ausmachen zu können, sein äußerlich unauffälliger, tatsächlich aber brisanter Aufsatz war in der Menge des Gesamtwerks, in dem schon unüberblickbaren Wust des klassischen Kanons untergegangen und mit ihm auch einige der bedenkenswertesten Ideen.
 |
|
Gemälde von Anton Graff |
Jörg Seidel,
27.03.2002
_______________
Anmerkungen:
1
Lediglich in Ernst Strouhals massivem Werk fand es Erwähnung: in einer etwas
uneindeutigen Anmerkung hält Strouhal den Text offensichtlich nur für eine
Übersetzung der frühen schachgeschichtlichen Untersuchung Frêrets „De l’origine
du jeu des Echecs“ von 1719 (vgl. Strouhal: Schach. Die Kunst des Schachspiels.
S. 57 und 176), gibt aber keinerlei Hinweis darauf, wie diese Meinung zu belegen
sei. Vieles dagegen spricht dafür, dass es sich hierbei um einen authentischen
Text Wielands handelt. Erstens hieße die korrekte Übersetzung „Die Ursprünge des
Schachspiels“, zweitens ist im Text oder in dessen Zusammenhang nirgends von
einer Übersetzung die Rede, drittens wird Frêrets Werk im Text selbst zitiert;
viertens sind in der so genannten „wohlfeilen Ausgabe“ letzter Hand – d.h. der
von Wieland zu Lebzeiten selbst herausgegeben Schriften - dessen tatsächlich
zahlreichen Übersetzungen nicht mit berücksichtigt worden (vgl. die editorische
Vorbemerkung Jan Philipp Reemtsmas in: Bd. 1, S. VI) und fünftens sind die
stilistischen Eigenheiten unübersehbar. Aber selbst, wenn es sich nur um eine
Übersetzung handeln sollte, so blieben die Hauptüberlegungen davon unberührt.
Dass der Text in der Wielandforschung bislang vermutlich unreflektiert blieb,
bestätigen Nachfragen bei der Wielandgesellschaft und dem Wielandmuseum.
2 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. München 1999 (1854). Band 31
3 Der Geist und die Geschichte des Schach-Spiels bei den Indern, Persern, ‚Arabern, Türken, Sinesen und übrigen Morgenländern, Deutschen und anderen Europäern. Halle 1798. Reprint Leipzig 1981
4 vgl. hierzu: Jörg
Seidel: Ondologie Fanomenologie Kynethik. S. 141 – 266, insbesondere die
Abschnitte: „Lob der Faulheit“ und „Plädoyer für ein neues Oblomowtum“; zu
Wieland insbesondere S. 159ff.
5
vgl. etwa: „Also sprach Zarathustra: „Von den drei Verwandlungen“ –
„Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich
rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-sagen. Ja, zum Spiele des
Schaffens, meine Brüder...“ KSA 4, S. 31
6
Wesen und Sinn des Spiels. Das Spielen der Menschen und der Tiere als
Erscheinungsform der Lebenstriebe: Berlin 1934
7
Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. (1938). Reinbek 1994
8
Spiele und die Menschen. Maske und Rauch (1958). München/Wien 1964
Startseite des SK König Plauen weitere Texte von Jörg Seidel
![]()
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am
27. März 2002.
Dieser Text ist geistiges Eigentum von Jörg Seidel und darf ohne seine
schriftliche Zustimmung in keiner Form vervielfältigt oder weiter verwendet
werden. Der Autor behält sich alle Rechte vor. Bitte beachten Sie dazu auch
unseren Haftungsausschluss.